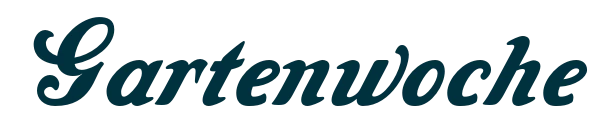Arven, die 500 Jahre alt werden können, prägen die Lebensgemeinschaft an der oberen Waldgrenze. Doch aufgrund ihrer langen Generationszeit können sie sich wohl nicht schnell genug an den rasanten Klimawandel anpassen – und möglicherweise lokal aussterben. Dies legt eine von der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL geleitete genetische Studie nahe.
Die Arve ist die «Königin» der oberen Waldgrenze – bis zu 500 Jahre alte, knorrige Bäume mit wohlriechendem Holz. Einst säumten Arven die Waldgrenze in weiten Teilen der Alpen. Alpwirtschaft, Wild- und Krankheitsschäden sowie die langjährige Dezimierung des Tannenhähers, der irrtümlich als Arvenschädling bekämpft wurde, liessen ihre Bestände schrumpfen, grössere zusammenhängende Arvenwälder gibt es in der Schweiz nur noch im Engadin und im Wallis. Nun kommt noch der Klimawandel hinzu. Wird es weiterhin wärmer und trockner, droht die Arve durch schnellwüchsige Konkurrenten aus tieferen Lagen – Fichten, Tannen, Föhren und Laubbäume – verdrängt zu werden.
Kann die Art rechtzeitig in höhere Lagen ausweichen, wo ihre Kältetoleranz ihr einen Wettbewerbsvorteil bietet? Forschende der WSL, der ETH und der Universität Zürich haben überprüft, ob die Jungbäume das genetische Rüstzeug für die Zukunft haben. Denn die behäbige Arve lässt sich mit der Fortpflanzung Zeit und bildet erst im Alter von 40 bis 60 Jahren reife Zapfen. Es ist daher zu befürchten, dass die heute keimenden Samen der Altbäume an das vergangene, kühlere und feuchtere Klima angepasst sind, das es gemäss den Klimamodellen so nicht mehr geben wird.
Das Forschungsteam analysierte über 3000 Gene bei mehreren Hundert Sämlingen und Altbäumen aus hohen und tiefen Lagen des schweizerischen Verbreitungsgebiets. Es fand heraus, welche Genvarianten bei welchen Umweltbedingungen vorteilhaft sind, und in welchen Beständen in welcher Höhenlage diese vorkommen. Es zeigte sich, dass Jungbäume auf hoch gelegenen Standorten sowohl für das aktuelle als auch für das zukünftige Klima die genetische Ausrüstung haben, berichten Erstautor Benjamin Dauphin und seine Kollegen im Fachjournal «Global Change Biology».
Vom Klimawandel abgehängt
Hingegen fanden sie bei jungen Bäumen in tiefen Lagen mehrheitlich die «falschen» Genvarianten, die im zukünftigen, wärmeren und trockeneren Klima nicht mehr vorteilhaft wären. «Die Nachkommen der heute lebenden Bäume werden dort an eine wärmere Zukunft weniger gut angepasst sein», sagt Felix Gugerli von der WSL-Forschungsgruppe Ökologische Genetik, der die Studie geleitet hat. Fachleute sprechen von einer «Anpassungschuld», wenn Arten aufgrund ihrer langen Generationszeit von Klimaveränderungen überrollt werden.


Damit die Arve in die Höhe vorstossen kann, braucht sie nebst den passenden Genen auch den Tannenhäher, der Arvensamen als Futterreserve versteckt, viele davon aber nicht frisst und diese dann keimen können. Ausserdem können Arven nur aufwachsen, wenn es genug Rohhumus gibt, der in hohen Lagen vielerorts noch nicht existiert, weil die Bodenentwicklung ein extrem langwieriger Prozess ist.
In Kombination mit weiteren Herausforderungen – Schäden durch Wild oder Skifahrer, krankheitserregende Pilze, die vom wärmeren Klima profitieren – könnte die Arve mancherorts in Bedrängnis geraten. «Die Art als solche werden wir nicht verlieren, aber die Vorkommen werden noch kleiner und zunehmend zerstückelt sein», sagt Gugerli. Dies erschwert den Austausch zwischen Beständen und kann zu Inzucht führen. In einzelnen Alpentälern könnte die Arve sogar aussterben.
Weil die Arve zusammen mit der Lärche das typische Waldökosystem an der oberen Baumgrenze prägt, würde somit eine ganze Lebensgemeinschaft in Schieflage geraten. Nebst dem Tannenhäher beträfe dies eine Vielzahl von Pilzen, Flechten und Insekten, die in diesen Wäldern heimisch sind.